Kosmetikhersteller dürfen Amazon ausschließen
Markenhersteller dürfen ihren Depotpartnern verbieten, ihre Produkte auf Plattformen wie Amazon oder Ebay anzubieten. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden. Laut Urteil sind solche Klauseln in den Verträgen nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Pauschale Plattformverbote verstoßen gegen das europäische Wettbewerbsrecht.
So können Anbieter von Luxuswaren wie hochpreisiger Dermokosmetik autorisierten Händlern zwar verbieten, die Ware über Drittplattformen wie Amazon oder Ebay zu verkaufen. Allerdings müsse das Verbot dazu dienen, das Luxus-Image der Ware sicherzustellen und in einem angemessenen Verhältnis zu diesem Ziel stehen. Außerdem müsse die Auswahl der Wiederverkäufer anhand von „objektiven Gesichtspunkten qualitativer Art“ erfolgen, also einheitlich festgelegt sein und nicht diskriminierend gegenüber einzelnen Händlern.
Stein des Anstoßes war der Hersteller Coty, der gegen einen seiner autorisierten Händler geklagt hatte. Denn Coty erlaubte den Händlern seines selektiven Vertriebsnetzes den Online-Verkauf seiner Luxusparfums lediglich innerhalb von deren eigenen „elektronischen Schaufenstern“ – also deren Homepages. Den Verkauf über Drittplattformen hingegen verbietet die deutsche Tochter des US-Konzerns.
Diesem Verbot widersetzte sich die Parfümeriekette Akzente und bot Luxuskosmetika von Coty auf Amazon an. Als Coty dagegen vorging, zweifelte das zuständige Oberlandesgericht Frankfurt am Main daran, dass die Vertragsklausel mit dem EU-Wettbewerbsrecht vereinbar ist, und befragte den EuGH.
Dieser kam nun zum Schluss, dass solche Plattformverbote nicht per se kartellrechtswidrig sind, sondern legitimer Teil von selektiven Vertriebsnetzen. Das Verbot gehe auch nicht über das hinaus, was erforderlich sei, um das Luxusimage der Waren sicherzustellen.
So heißt es im Urteil: „Insbesondere kann es – mangels einer Vertragsbeziehung zwischen dem Anbieter und den Drittplattformen, die es dem Anbieter erlauben würde, von den Plattformen die Einhaltung der Qualitätsanforderungen zu verlangen, die er seinen autorisierten Händlern auferlegt hat – nicht als ebenso wirksam wie das streitige Verbot angesehen werden, wenn diesen Händlern gestattet würde, solche Plattformen unter der Bedingung einzuschalten, dass sie vordefinierte Qualitätsanforderungen erfüllen.“
Viele Vertriebsspezialisten dürften nun aufatmen, da mit der höchstrichterlichen Entscheidung eine seit mehreren Jahren uneindeutige Rechtssituation beendet wurde. Denn bisher waren sich die Gerichte uneins. So billigte beispielsweise das OLG Karlsruhe 2010 ein vertragliches Verbot des Vertriebs über Ebay, drei Jahre später urteilte das Berliner Kammergericht hingegen in einem ähnlichen Fall, dass das Verbot unzulässig sei. Nun herrscht also Klarheit, aber nicht überall Zufriedenheit.
Während Rechtsanwalt Oliver Spieker von der Wirtschaftskanzlei Görg das Urteil als „gutes Zeichen für den Online-Handel“ wertet, zeigt sich sein Kollege Thomas Funke gegenüber dem Fachportal Legal Tribune Online wenig begeistert: „Der Apfel, den die europäischen Richter den Herstellern zum Nikolaustag in den Stiefel stecken, könnte vergiftet sein“, kritisiert der Jurist, der die Abteilung Kartellrechtspraxis bei der internationalen Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke leitet. Die Entscheidung stelle den Plattformvertrieb über Amazon & Co. „in die Schmuddelecke“. Dabei biete er durchaus Chancen, eine Marke angemessen darzustellen.
Außerdem müssen Gerichte nun in Zukunft eine weitere Frage klären: was Luxus in einem rechtlichen Sinne überhaupt ist. Der EuGH hat in seinem Urteil festgestellt, dass die Qualität von Luxuswaren nicht allein auf ihren materiellen Eigenschaften beruht, sondern auch auf ihrem Prestigecharakter. Wie das juristisch verbindlich zu definieren ist, müssen die Gerichte in künftigen Einzelfallentscheidungen beurteilen.
Vor einigen Jahren hatte der Kosmetikhersteller Wala strenge Regeln für Online-Händler seiner Hauschka-Produkte erlassen. Weil Versandapotheken meistens mehr auf den Preisvorteil als auf die Beratung achten, ließ der Hersteller aus Bad Boll wenig unversucht, diesen Vertriebskanal klein zu halten. So war im Markenpartner-Vertrag geregelt, dass der Onlineshop nicht anders heißen darf als die dazugehörige Apotheke vor Ort. Bestimmte Namenszusätze wurden ganz verboten – weil sie nicht zu der Marke passten.



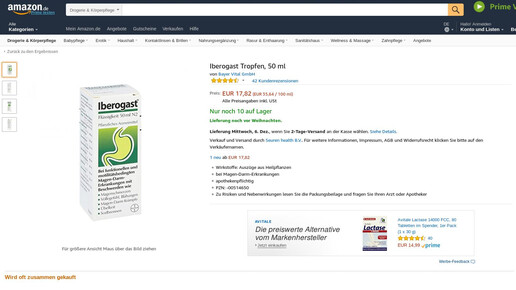






























APOTHEKE ADHOC Debatte